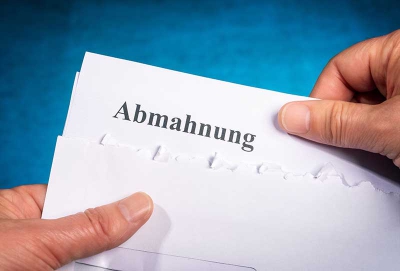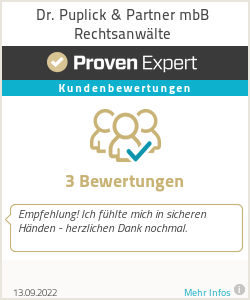BGH, Urteil vom 07.03.2024, Az. I ZR 83/23
Das Praxisproblem
Wettbewerbsrechtliche Abmahnungen sind für Unternehmer eine vom Gesetzgeber vorgesehene (sinnvolle) Möglichkeit, sich gegen unlauteres Verhalten von Wettbewerbern zur Wehr zu setzen.
Leider nutzen auch viele unseriöse Unternehmen und „Abmahnvereine“ das Wettbewerbsrecht, um Einkünfte zu „generieren“.
In einem Abmahnschreiben wird der Abgemahnte dazu aufgefordert, das unlautere, wettbewerbswidrige Verhalten – beispielsweise eine Werbung unter Verstoß gegen vorgeschriebene Angaben zur Produktbeschaffenheit – zukünftig zu unterlassen und die Zahlung einer Vertragsstrafe zu versprechen, wenn es gleichwohl zu einem erneuten Verstoß kommt. Wird die geforderte strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung nicht abgegeben, schließt sich regelmäßig ein gerichtliches Verfahren an, in dem geklärt wird, ob das beanstandete Verhalten tatsächlich rechtswidrig war.
Ist eine strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung abgegeben worden und kommt es erneut zu einem wettbewerbswidrigen Verhalten, ist die Vertragsstrafe an den Abmahner zu zahlen. Ist das wettbewerbswidrige Verhalten hingegen durch ein Gerichtsurteil festgestellt worden, führt ein erneuter Verstoß zu einem an die Staatskasse zu zahlenden Ordnungsgeld.
Wird die Abmahntätigkeit alleine ausgeübt, um Ansprüche auf Aufwendungsersatz und gegebenenfalls Vertragsstrafen geltend zu machen, ist dieses unzulässig. Von der Rechtsprechung sind Kriterien aufgestellt worden, bei deren Vorliegen auf eine unzulässige Abmahntätigkeit geschlossen werden kann.
Die Entscheidung
Der BGH hat sich in einer jetzt veröffentlichten Entscheidung vom 07.03.2024 mit einem Sachverhalt befasst, bei dem ein Interessenverband von Online-Unternehmen den Beklagten wegen behaupteter Wettbewerbsverstöße abgemahnt hatte. Der Beklagte hatte eine Unterlassungserklärung abgegeben, nachfolgend war es dann aber zum einem erneuten Wettbewerbsverstoß gekommen.
Der Beklagte weigerte sich die Vertragsstrafe zu bezahlen und machte geltend, bereits die Abmahnung sei unzulässig gewesen, weil diese alleine im Gewinnerzielungsinteresse ausgesprochen worden sei. Er berief sich dabei darauf, dass in dem fraglichen Jahr von der Klägerin 3.520 Abmahnungen ausgesprochen worden seien, wobei in 1.325 Fällen Unterlassungserklärungen abgegeben worden sind. Von den verbleibenden 2.195 Fällen seien von dem Kläger aber nur 528 Fälle gerichtlich geklärt worden, die übrigen 1.667 Fälle seien nicht weiter verfolgt worden.
Die Vorinstanzen hatten aus diesem Verhalten des Klägers geschlossen, dass ein rechtsmissbräuchliches Verhalten vorliegt.
Der BGH hat die Angelegenheit differenzierter betrachtet. Er hat ausgeführt, dass es durchaus ein starkes Indiz für ein rechtsmissbräuchliches Vorgehen des Klägers sei, wenn er in einer Vielzahl von Fällen trotz nicht abgegebener strafbewehrter Unterlassungserklärungen kein gerichtliches Verfahren zur Klärung des Sachverhaltes durchführt. Dies könnte dafür sprechen, dass die Abmahntätigkeit lediglich erfolgt, um Ansprüche auf Aufwendungsersatz oder gegebenenfalls die Zahlung einer Vertragsstrafe geltend zu machen.
Nach Auffassung des BGH spricht für einen Verein grundsätzlich die Vermutung, dass dieser satzungsmäßigen Zwecken nachgeht. Ist diese Vermutung erschüttert, wie im vorliegenden Fall durch den Vortrag des Beklagten, dass der Verein in einer Vielzahl von Fällen Abmahnungen nicht weiterverfolgt hat, obwohl keine strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung abgegeben worden ist, obliegt es dem Kläger darzulegen, warum keine gerichtliche Verfolgung stattgefunden hat.
Im konkreten Fall hatte der Kläger vorgetragen, er habe eine Reihe von Musterverfahren geführt und habe deren Ausgang zunächst abwarten wollen. Mit dieser Argumentation des Klägers habe sich das Berufungsgericht nicht auseinandergesetzt, so der BGH. Zu klären sei auch, inwieweit der Kläger die Fälle nach dem Abschluss der Musterverfahren wieder aufgegriffen habe.
Ein Kriterium, welches gegen ein rechtsmissbräuchliches Abmahnverhalten des Klägers sprechen könnte, sei es beispielsweise, wenn von dem Kläger bei erneutem Fehlverhalten nach gerichtlich festgestellten Wettbewerbsverstößen in einem erheblichen Umfang Ordnungsgeldanträge zugunsten der Staatskasse gestellt werden.
Weitere Kriterium, welches für ein missbräuchliches Verhalten des Klägers sprechen könnte, sei es, wenn mit dem Abmahnschreiben zugleich auch eine vorformulierte Unterlassungsverpflichtungserklärung vorgelegt wird und hierbei der Eindruck erweckt wird, dass ein gerichtliches Verfahren nur vermieden werden kann, wenn die vorformulierte Erklärung unterzeichnet wird. Tatsächlich ist dieses nicht der Fall, einem Abmahnschreiben kann eine vorformulierte Erklärung beigefügt werden, es steht dem Abgemahnten aber frei auch eine selbst formulierte Erklärung abzugeben.
Da sich das Berufungsgericht mit den vorgenannten Punkten nicht auseinandergesetzt hatte, hat der BGH die Entscheidung des Berufungsgerichtes aufgehoben und das Verfahren zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Die Praxisempfehlung
Der vorliegende Sachverhalt zeigt exemplarisch, dass bei Eingang einer Abmahnung oder einer Aufforderung zur Zahlung einer Vertragsstrafe, umgehend anwaltliche Hilfe – am besten die Hilfe eines Fachanwaltes für gewerblichen Rechtsschutz – in Anspruch genommen werden sollte.
Gerne beraten wir Sie bei allen Fragen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes – sprechen Sie uns an!